
Die Rolle Chinas bleibt unverändert – weiterhin ist China einer der Big Player in der Wirtschaft.
Die Weltwirtschaft steht kurz vor einer Krise oder befindet sich gar schon mittendrin.
Angesichts der aktuellen Lage, ausgelöst durch den Ausbruch des Sars-CoV-2-Virus, ist das nicht allzu verwunderlich. Startpunkt war aber die Einschränkung Chinas durch den dortigen Beginn der Epidemie.
Die Handlungsunfähigkeit chinesischer Unternehmen und Märkte zeigte im europäischen Raum bereits spürbare Ausläufer, noch bevor die ersten Fälle des Coronavirus hierzulande vermehrt auftraten.
1. Wie groß ist die Rolle Chinas im internationalen Welthandel?
Dass China eine wichtige Rolle für den Welthandel spielt, ist jedermann bewusst.
Doch angesichts der aktuellen Lage stellen sich die Fragen:
- Wie abhängig sind wir eigentlich von der Volksrepublik?
- Funktioniert in Europa ohne China noch etwas?
Zur Beantwortung dieser Fragen empfiehlt sich ein Blick in die Vergangenheit, vor den Ausbruch der aktuellen Epidemie.
Im Jahr 2012 sanken reihenweise die Aktienkurse mehrerer europäischer und internationaler Firmen, darunter der weltgrößte Autohersteller Toyota, Baumaschinenhersteller Caterpillar und sogar die Luxus-Modemarke Burberry.
2. Nimmt China eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft ein?
China ist laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) für 78 Länder der primäre oder zweit wichtigste Handelspartner. Eine Schlüsselrolle für den globalen Handel lässt sich kaum abstreiten.
Die Volksrepublik konnte ihre Vorreiterstellung in den letzten beiden Jahrzehnten stetig erzeugen und verbessern, zweifellos ist Chinas Wirtschaft fest verknüpft mit denen anderer großer Industrieländer.
Ebendiese Wirtschaften spüren eine Abschwächung Chinas unmittelbar.
Viele Unternehmen bauen hauptsächlich oder zumindest zu einem sehr großen Teil auf die Nachfrage aus Fernost. Bleibt diese plötzlich aus oder ebbt ab, bedeutet dies eine prekäre Lage für die entsprechenden Firmen.
Ebendas passierte vor einigen Jahren. Ein Zusammenspiel aus bremsender Geldpolitik in Peking und einem Ausfall von Nachfrage aus Europa waren die Ursache für eine deutliche Abschwächung des chinesischen Wirtschaftswachstums. Zwei Jahre vorher waren es noch fast zwölf Prozent – nun waren es zwei.
3. Gibt es eine Studie, die zeigt, welche Rolle China einnimmt?
3.1. China kann auch Deutschlands Wirtschaft treffen
Kann Deutschland mithalten?
Eine Studie des IWF berechnete zu diesem Zeitpunkt die Auswirkungen chinesischer Investitionen auf die Weltwirtschaft, um erkenntlich zu machen, wie empfindlich diese auf einen Abschwung in Fernost reagiert.
Nicht nur unmittelbar mit China verknüpfte Länder wie Taiwan, Japan oder Malaysia würden hart getroffen, sondern auch die sehr exportorientierte deutsche Wirtschaft würde in Mitleidenschaft gezogen werden.
Rechnete man auch indirekte Effekte mit ein, könnte die Wirtschaft der Bundesrepublik gar diejenige sein, die von einem Abschwung Chinas am stärksten getroffen werden würde.
Nur Finnland hat innerhalb der EU eine ähnlich starke China-Ausrichtung, was den Export betrifft.
3.2. Anfang 2012 sank der Export
Besonders die deutsche Industrie ist daher schmerzhaft von konjunkturellen Abkühlungen Chinas getroffen.
Daten des Maschinenbauverbandes VDMA zeigen, dass die Exporte nach China in den ersten sieben Monaten des Jahres 2012 um 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sanken.

Die Nachfrage nach Stahl aus China macht bereits 65 % aus.
Aber nicht nur die Maschinenbauindustrie ist betroffen und auch nicht nur Deutschland. Leidtragende einer Abschwächung chinesischer Konjunktur sind auch Rohstoffproduzenden von Brasilien bis Angola.
Die hohe Nachfrage von Ressourcen aus China hat ebendiesen Wirtschaften über mehrere Jahre einen regelrechten Boom beschert. Denn China brauchte für die Fertigung der Milliarden von Fabrikprodukten jedes Jahr natürlich Zutaten. Gar als „Rohstoff-Superzyklus“ wurde dieser Vorgang bezeichnet – nie zuvor in der modernen Geschichte sind die Rohstoffpreise so stark gestiegen wie in den letzten 15 Jahren.
Chinas Nachfrage nach Stahl allein stieg über Jahre stetig um 15 bis 20 Prozent. Während die Volksrepublik in den 90er Jahren bei den globalen Importen von Eisenerz noch für einen Anteil von weniger als 10 Prozent verantwortlich war, sind es heute über 65 Prozent.
4. Fazit: Wie sieht die Situation mittlerweile aus?
Zwar folgte in diesem Jahr zu einem gewissen Grad eine Erleichterung. Die chinesischen Umsätze im Einzelhandel legten wieder zu, die Industrie produzierte wieder mehr.
Dennoch: Langfristig vermuten einige Ökonomen einen Trend, der schwächeres Wachstum zur Folge hat. Pekings Ziel bzw. Fokus bewegt sich zunehmend weg von Exporten und mehr in Richtung Binnenkonsum. Chinas Nachfragecharakter werde sich fraglos wandeln.
„Zwar dürften große Infrastrukturinvestitionen weiter gute Geschäfte für Firmen wie Siemens, General Electric und Caterpillar bedeuten, doch die Nachfrage wird sich insgesamt Richtung Konsumgüter verschieben“, so Jagdish Bhagwati, Globalisierungsexperte an der Columbia University.
Die Frage, die sich gestellt werden muss, ist also nicht die nach dem Ob, sondern nach dem Wann. Wie viel Zeit bleibt den Firmen in Deutschland und aller Welt noch, sich auf diesen generellen Wandel der chinesischen Nachfrage einzustellen?
Bildnachweise: Novikov Aleksey/Shutterstock, Novikov Aleksey/Shutterstock, Bannafarsai_Stock/Shutterstock, (nach Reihenfolge im Beitrag sortiert)



Festgeld-Vergleich
Geben Sie die Laufzeit vor, ftd.de findet die besten Zinsen

Tagesgeld-Vergleich
Mit dem Einlagensicherungscheck sind Sie auf der sicheren Seite
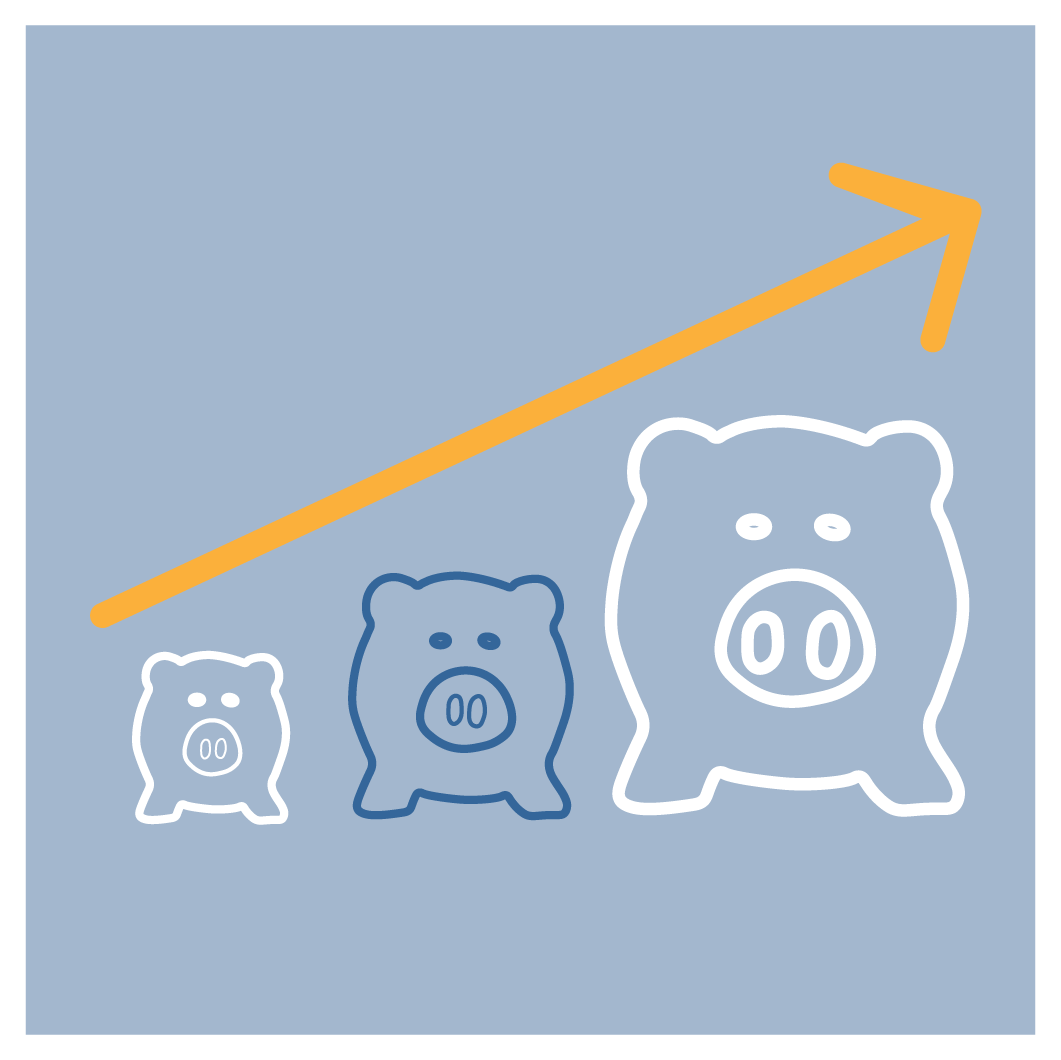
Depot-Vergleich
Ohne den Vergleich von ftd.de sollten Sie kein Depot eröffnen

Geschäftskonten-Vergleich
Geschäftskonten müssen kein Geld kosten – sparen Sie mit ftd.de

Ratenkredit-Rechner
Ratenkredite wechseln häufig den Zins – sparen Sie bares Geld
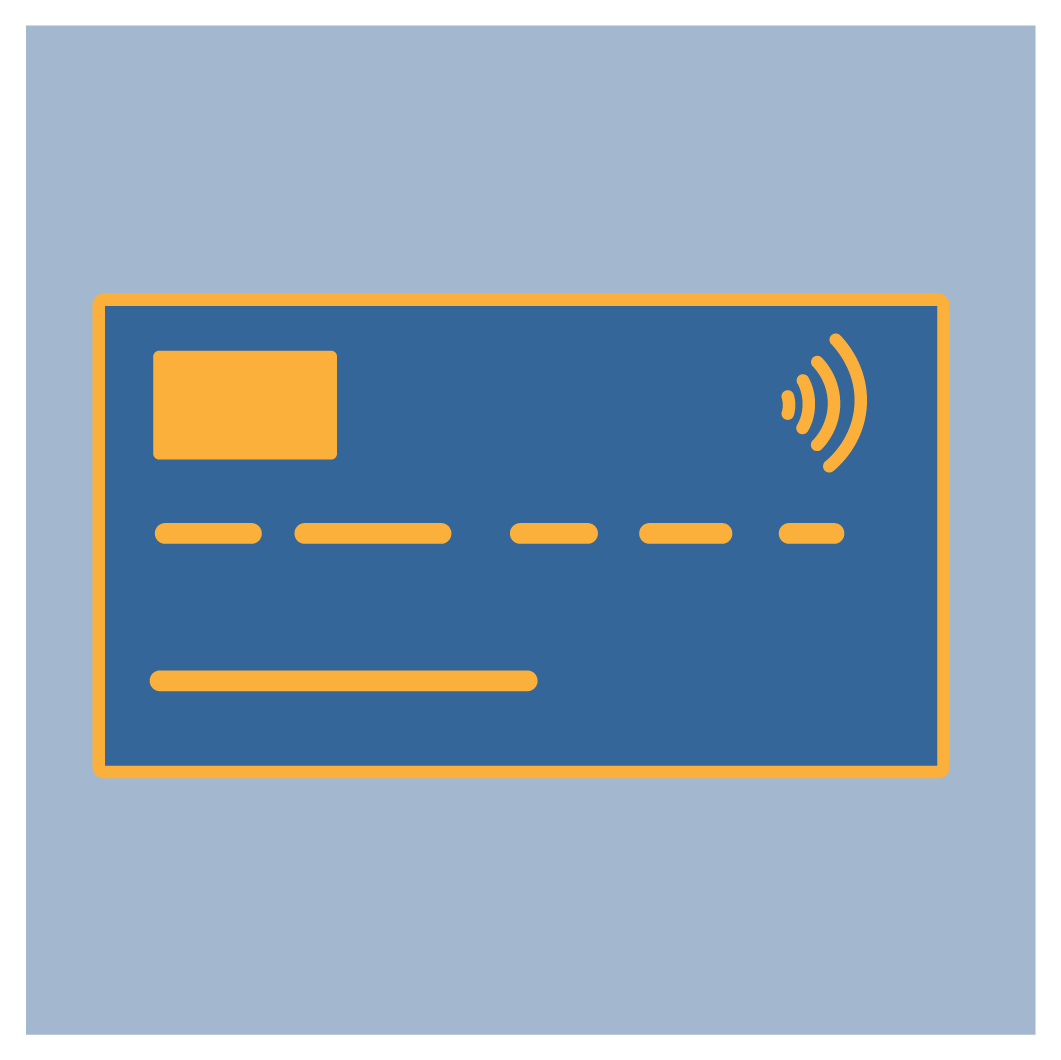
Kreditkarten-Vergleich
Finden Sie schnell und einfach die günstigste Kreditkarte



















