München (pte020/11.08.2021/10:30) – Forscher der Technischen Universität München (TUM) http://tum.de haben die lebenden Bakterien der Haut mittels Sequenzierung und mithilfe des Enzyms Benzonase entschlüsselt. Die Methode eröffnet laut den Wissenschaftlern neue Möglichkeiten der Diagnose und Therapie für die Dermatologie. „Unser Ziel ist es herauszufinden, welche Rolle die verschiedenen Hautbakterien bei Erkrankungen wie Neurodermitis oder Akne spielen“, so TUM-Wissenschaftler Martin Köberle.
Enzym Benzonase hilfreich
Für ihre Studie haben die Experten eine besondere Fähigkeit des Enzyms Benzonase genutzt. Dieses zerstört die Nukleotid-Ketten, die bei allen Lebewesen die Erbinformation tragen, indem sie diese in kleine Stücke zerlegen. Ausgenommen von dieser enzymatischen Zerstörung sind nur lebende Bakterien, deren Erbgut durch eine Zellwand geschützt ist.
Benzonase wird schon seit Längerem eingesetzt, um etwa Proteine aufzureinigen: Die Enzyme zerlegen alle störenden DNA- und RNA-Bruchstücke, diese können anschließend in einer Zentrifuge entfernt werden. Übrig bleiben die Proteine. Die Selektion der Hautbakterien funktioniert nach dem selben Prinzip: Genstücke aus Hautzellen oder tote Bakterien werden vom Enzym zerkleinert und lassen sich abtrennen. Die übriggebliebenen Bakterien kann man mechanisch zerstören und dann gezielt deren DNA untersuchen.
Fremd-DNA komplett eliminiert
„Mit dieser Methode lässt sich tatsächlich die Fremd-DNA vollständig eliminieren und das Mikrobiom der Haut selektieren“, sagt Projektleiter Yacine Amar. Im Labor hat er künstlich hergestellte Proben, bei denen menschliche Zellen, tote und lebende Bakterien nach einem strengen Protokoll gemischt worden waren, mit Benzonase vorbehandelt. „Das anschließend verwendete Verfahren hat sehr präzise die Zusammensetzung der intakten Bakterien wiedergegeben.“ Auch die Analyse von echten Hautabstrichen sei erfolgreich verlaufen: In den Proben wurde keine Rest-DNA von toten Bakterien gefunden.
Quelle: www.pressetext.com
Bildnachweise: Proben im Labor: TUM-Forschern gelingt Sequenzierung (Foto: tum.de, Juli Eberle) (nach Reihenfolge im Beitrag sortiert)



Festgeld-Vergleich
Geben Sie die Laufzeit vor, ftd.de findet die besten Zinsen

Tagesgeld-Vergleich
Mit dem Einlagensicherungscheck sind Sie auf der sicheren Seite
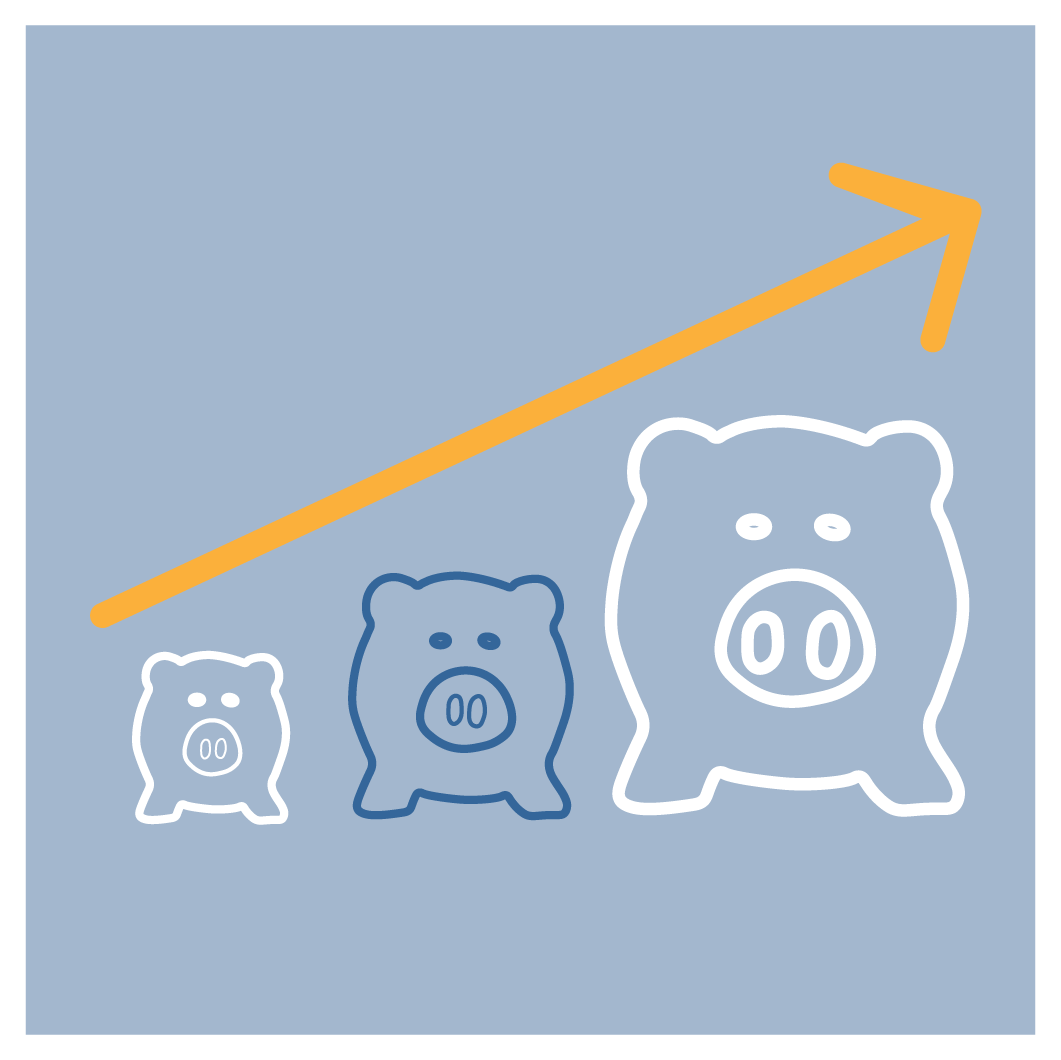
Depot-Vergleich
Ohne den Vergleich von ftd.de sollten Sie kein Depot eröffnen

Geschäftskonten-Vergleich
Geschäftskonten müssen kein Geld kosten – sparen Sie mit ftd.de

Ratenkredit-Rechner
Ratenkredite wechseln häufig den Zins – sparen Sie bares Geld
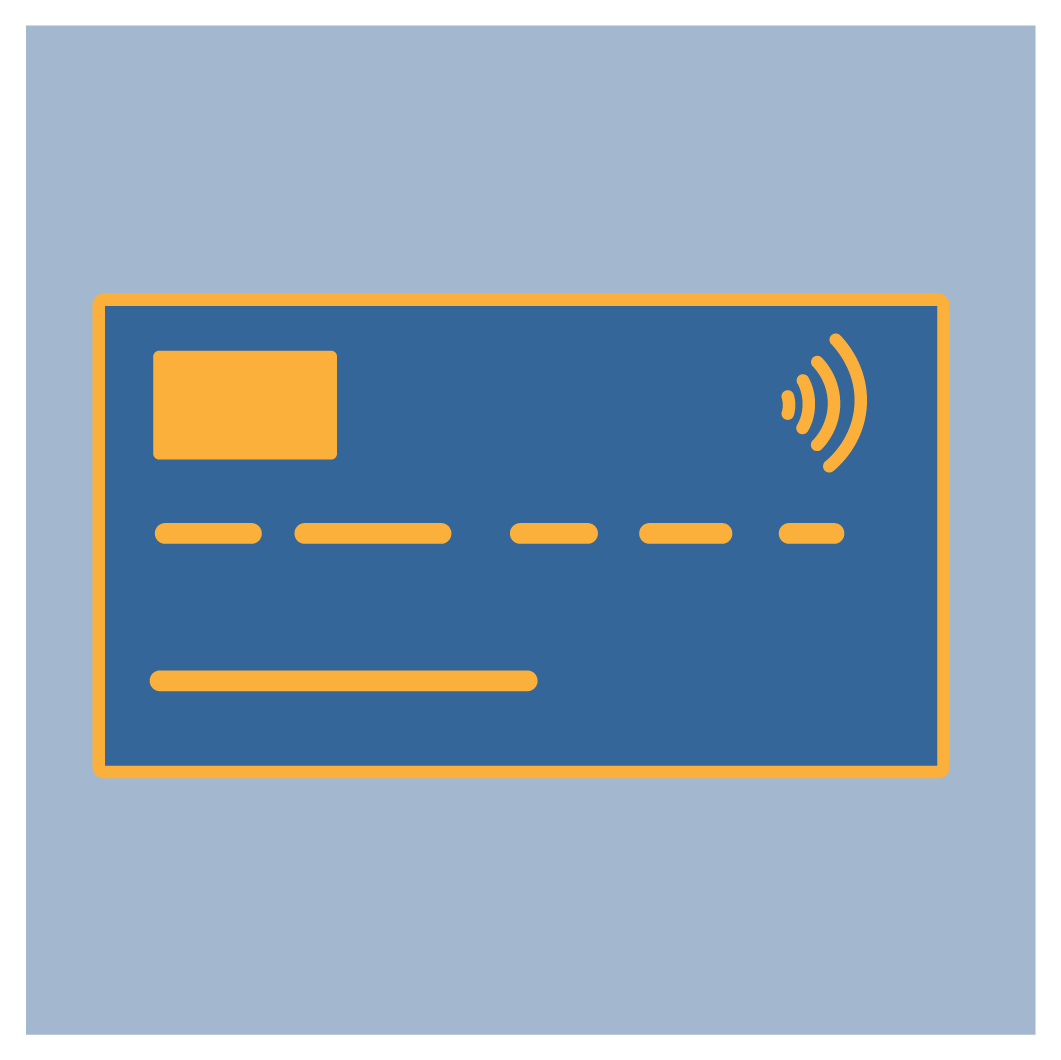
Kreditkarten-Vergleich
Finden Sie schnell und einfach die günstigste Kreditkarte



















